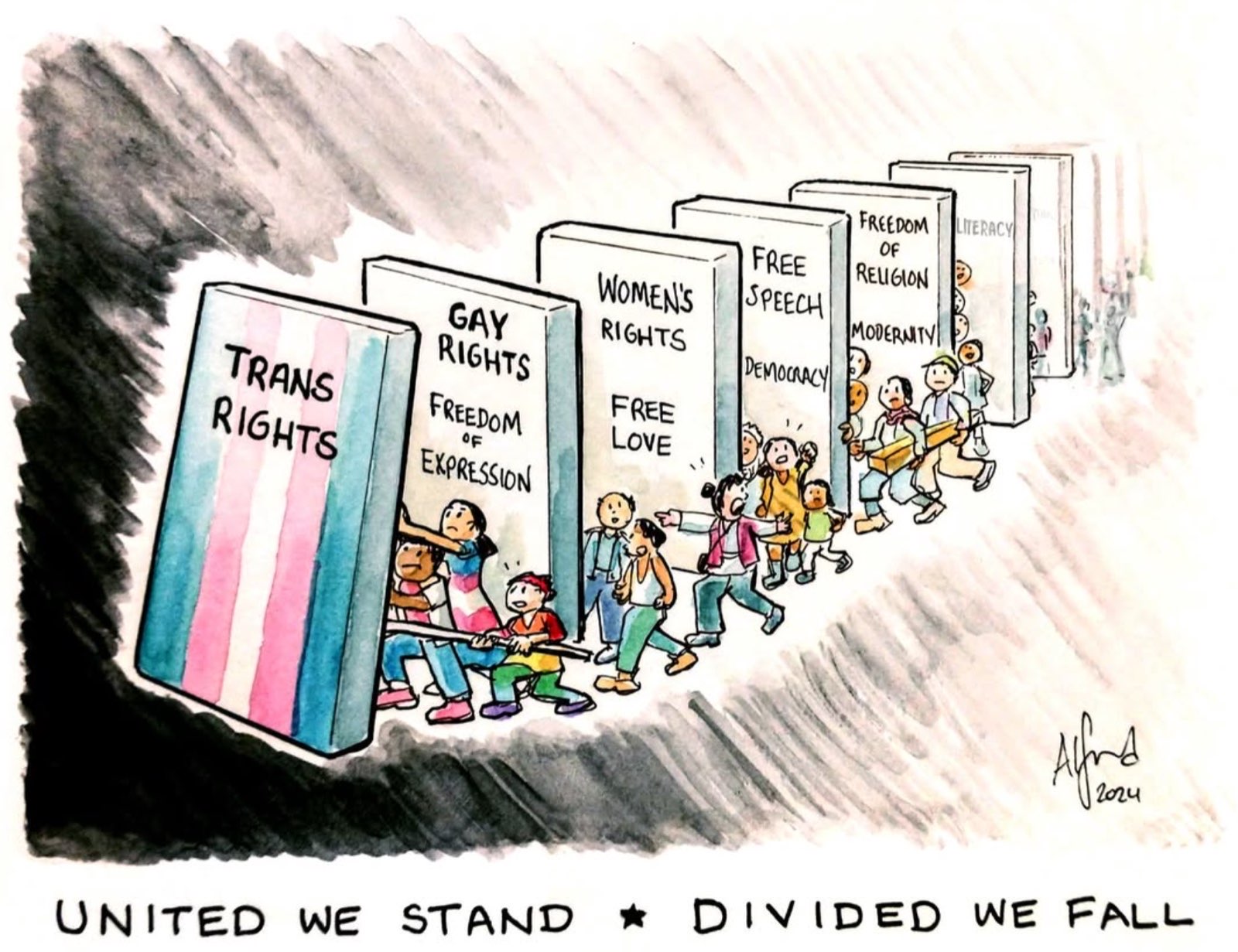Von Soz. Arbeiterin einer Opferhilfeberatungstelle des Kanton Berns
In den letzten Jahren haben wir Mitarbeiterinnen von Solidarité Femmes festgestellt, dass sich in unseren Beratungsgesprächen die Schilderungen der Klient*innen mehren, wie sich Täter¹ technische Mittel und digitale Medien zunutze machen, um Gewalt gegen sie zu verüben. Beispielsweise berichten Klient*innen davon, dass Ex-Partner – als Reaktion auf ihr Trennungsbegehren und/oder um mehr Kontrolle über sie zu erlangen – sie mit einer Vielzahl von Nachrichten und Anrufen terrorisieren, Online-Käufe in ihrem Namen tätigen, ihre Mobiltelefone und/oder Social-Media-Konten hacken oder sie damit bedrohen und erpressen, einvernehmliche oder heimlich aufgenommene Nacktfotos bzw. pornografisches Material zu verbreiten.
Hinzu kommt, dass Täter zunehmend ‘Spyware’ nutzen, um sich aus der Ferne Zugriff auf die Mobiltelefone der Betroffenen zu verschaffen, in ihre Chatverläufe einzusehen und deren Standorte nachzuverfolgen. Auch Ortungsgeräte, sogenannte ‘AirTags’, werden gemäss unseren Beobachtungen in der Praxis vermehrt von Tätern verwendet, um den Standort der betroffenen Personen gezielt nachzuverfolgen.
In der Fachliteratur wird die Ausübung geschlechtsspezifischer Gewalt durch die Inanspruchnahme technischer Hilfsmittel und digitaler Medien – wie Mobiltelefone, Apps, E-Mails und die allgemeine Nutzung des Internets – als digitale Gewalt bezeichnet (bff & Prasad, 2021). Der Begriff digitale Gewalt wird dabei als Sammelbegriff verwendet (ebd.). Gemäss Prasad wird durch digitale Gewalt die Wirkung analog ausgeübter Gewalt verstärkt, wobei sich physische, psychische, sexualisierte und digitale Gewalt zunehmend ineinander verschränken (Prasad, 2021). Digitale Gewalt setzt Betroffene häuslicher Gewalt, die mehrheitlich in ihrem Zuhause Gewalt erleben, nun zusätzlich – unabhängig von ihrem Aufenthaltsort – einer ständigen Bedrohung durch die Täter aus (Frey, 2020).
Zur genaueren Unterscheidung der einzelnen Gewalthandlungen, die diesem Oberbegriff zugeordnet werden können, werden spezifische Begriffe verwendet.
Der Begriff ‘Online- oder Cyberstalking’ bezieht sich beispielsweise unter anderem auf Handlungen wie Nachrichtenterror, kostenintensive Online-Bestellungen im Namen der betroffenen Person sowie deren Überwachung mittels ‘AirTags’ oder ‘Spyware’ (Prasad, 2021).
Der Begriff ‘Doxing’ beschreibt wiederum, wie Täter heimlich im Namen der betroffenen Personen Online-Profile erstellen, um über diese Falschinformationen zu verbreiten, die das Ansehen der betroffenen Person schädigen können (Prasad, 2021).
Ausserdem beschreibt der Begriff ‘bildbasierte sexuelle Ausbeutung’, wie Täter ursprünglich einvernehmlich erstellte Nacktfotos und/oder pornografisches Material der Betroffenen ohne deren Zustimmung im Internet und/oder beispielsweise im Bekanntenkreis verbreiten (Policy Department for Citizen’s Rights and Constitutional Affairs, 2018).
Das Herstellen und Verbreiten heimlich aufgenommener Nacktfotos sowie pornografischen Materials oder die Drohung, dies zu tun, stellt ebenfalls eine Form digitaler Gewalt dar, die von Tätern im häuslichen Kontext angewendet wird (Prasad, 2021). Der englische Begriff ‘Upskirtin’ bezeichnet das heimliche, nicht einvernehmliche Fotografieren unter dem Rock einer Person (ebd.).
Eine weitere Form digitaler Gewalt ist das sogenannte ‘Deepfaking’ (Der Standard, 2018; Cole, 2018). Dieser Begriff bezeichnet unter anderem die Verfälschung von Bildmaterial, bei der beispielsweise Gesichter aus Fotografien in pornografische Inhalte eingefügt werden (ebd.).
In unserem beruflichen Handeln beraten und begleiten wir Klient*innen, die von ‘Cyberstalking’, ‘Doxing’ sowie anderen in diesem Text genannten Formen digitaler Gewalt betroffen sind – oder die aufgrund von Drohungen befürchten müssen, künftig davon betroffen zu sein. Um Klient*innen dabei zu unterstützen, sich vor diesen verschiedenen Formen der digitalen Gewalt zu schützen, empfehlen wir, bestimmte Hilfsmittel zu nutzen und Leitfäden zur digitalen Sicherheit zu beachten.
Hilfsmittel, die zum Schutz vor digitaler Gewalt genutzt werden können, sind beispielsweise Faraday Taschen und VPN-Server. Faraday-Taschen ermöglichen es, Mobiltelefone, Laptops und andere digitale Geräte von elektromagnetischen Signalen abzuschirmen. Daher sollten Betroffene, die gehackt und/oder getrackt wurden, ihre jeweiligen Geräte in solchen Taschen aufbewahren, damit Täterpersonen weder den Standort nachverfolgen noch weitere Konten hacken können. Die Nutzung eines VPN-Servers bietet wiederum den Schutz, sowohl der Standort als auch die Online-Identität der Nutzerperson zu verschleiern (Kantonspolizei Bern, 2024; Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, o.D.). Beim Surfen im Internet wird für die besuchte Webseite nicht die echte IP-Adresse angezeigt, sondern die des VPN-Servers. So bleibt die eigene IP-Adresse geschützt, und das Ausspähen oder Abfangen von Daten wird deutlich erschwert (ebd.).
Auf der Webseite der Berner Fachstelle ‘Stalking-Beratung’ finden Betroffene digitaler Gewalt – insbesondere von Cyberstalking – verschiedene hilfreiche Leitfäden. Empfohlen wird unter anderem, den Ortungsdienst zu deaktivieren, ein neues Google-Konto zu erstellen sowie die Geräteliste der Apple-ID auf unbekannte Zugriffe zu überprüfen und gegebenenfalls entsprechende Geräte zu entfernen. Zu diesen Schritten sind jeweils passende Anleitungen verlinkt.
Der gemeinnützige Verein ‘Tech against Violence’ hat den Online-Speicher ‘Safe with you’ entwickelt, um Betroffene von Gewalt dabei zu unterstützen, Beweise für Gewalttaten sicher aufzubewahren. Durch die Möglichkeit, Beweise auf diesem unabhängigen und sicheren Online-Speicher aufzubewahren, wird das Risiko verringert, dass Täter Zugang zu den Beweismitteln erhalten und diese löschen.
Es gibt auch juristisch Möglichkeiten gegen Täter digitaler Gewalt vorzugehen. Derzeit gibt es aber keine ausdrücklichen Strafnormen im Schweizer Strafgesetzbuch, welche Stalking – und damit auch Cyberstalking – als eigenständiges Delikt behandeln (Schweizer Eidgenossenschaft, 2024; Direktion für Sicherheit Umwelt und Energie der Stadt Bern, 2023). Auch für im digitalen Raum verübte Delikte bestehen keine ausdrücklichen Strafnormen (Das Advokaturbüro, 2024). Im Mai 2019 wurde im Nationalrat eine parlamentarische Initiative eingereicht mit dem Ziel, Stalking ausdrücklich strafrechtlich zu erfassen. Da diese Initiative im Februar 2024 bislang lediglich in der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates zu einem Entwurf für ein entsprechendes Bundesgesetz geführt hat, müssen bestehende Strafnormen derzeitig weiterhin an (Cyber-)Stalking und digitale Gewalt im Allgemeinen angepasst werden (Direktion für Sicherheit Umwelt und Energie der Stadt Bern, 2023). Nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivilrecht können juristische Mittel verwendet werden, um gegen Täter digitaler Gewalt vorzugehen (Das Advokaturbüro, 2024). Die Polizei, Opferhilfeberatungsstellen sowie Anwält*innen können Betroffene über die relevanten Tatbestände informieren, die zur Verfolgung der Täter angewendet werden können.
In manchen Fällen kann eine Situation, in welcher digitale Gewalt ausgeübt wird, auch durch eine schriftliche Abmahnung durch eine*n Anwält*in an den Täter entschärft werden (Das Advokaturbüro, 2024). Ein möglicher Vorteil dabei ist, dass die betroffene Person aus dem direkten Fokus des Täters rückt und die Kommunikation über die jeweiligen Rechtsvertretungen erfolgt. Betroffenen Personen wird zudem empfohlen, Worten Taten folgen zu lassen und Strafanzeige zu erstatten, wenn der Täter trotz Abmahnung weiterhin strafbare Handlungen begeht (ebd.).
[1] In diesem Text wird der Begriff ‘Täter’ bewusst ausschliesslich in der männlichen Form verwendet, da diverse Studien zeigen, dass Gewalt im häuslichen Kontext überwiegend von Männern verübt wird (Bundesamt für Statistik, 2025).