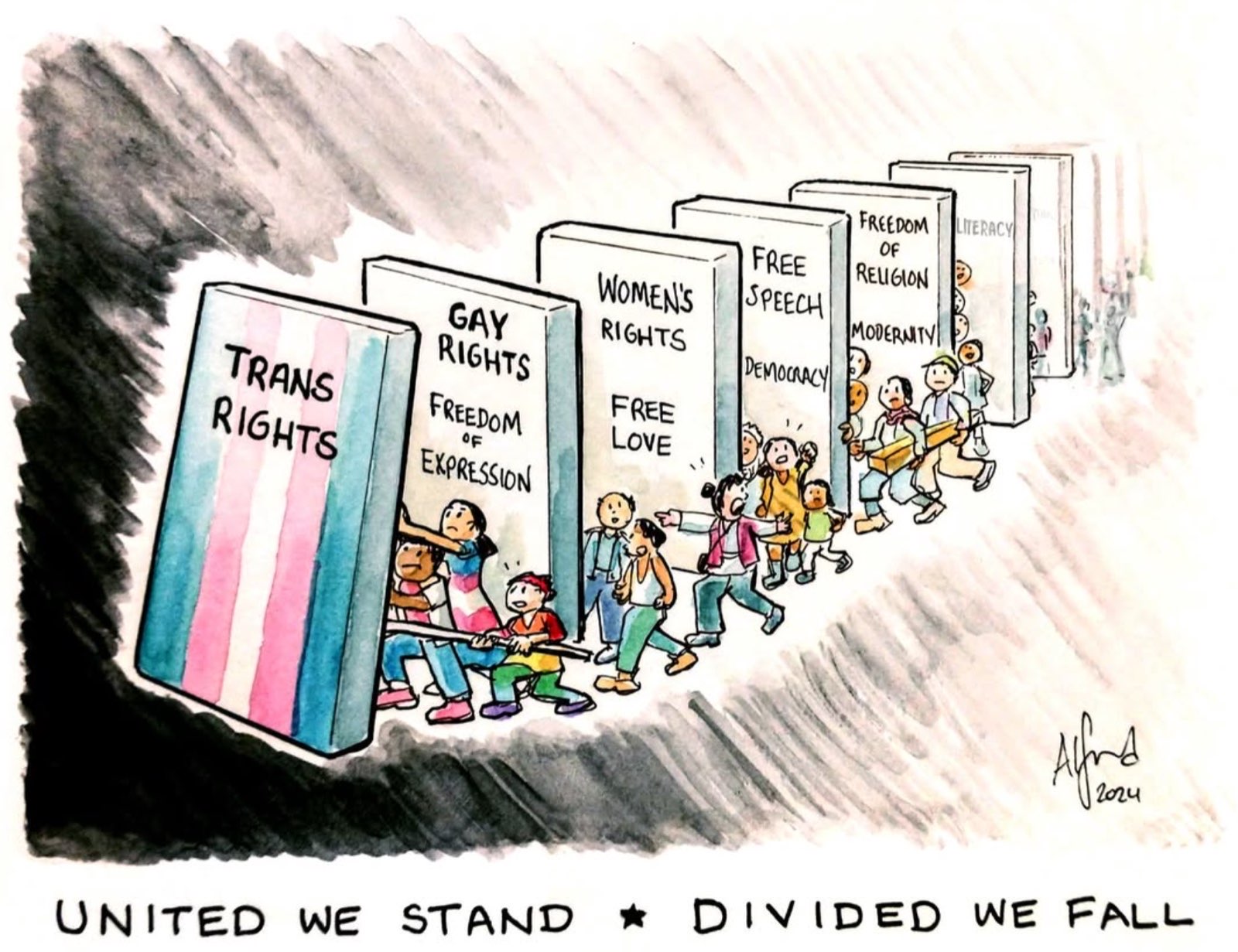von Lionel
Grossanlässe wie die Frauenfussball-Europameisterschaft oder der Eurovision Song Contest sorgen regelmässig für politische Diskussionen. Immer wieder werden sie mit queerfeministischen Anliegen in Verbindung gebracht. Doch ist dieser Zusammenhang berechtigt? Und sind solche Grossanlässe ein Teil einer queerfeministischen Revolution oder doch nur eine weitere Kommerzialisierung?
Der Eurovision Song Contest ist längst mehr als ein Musikwettbewerb – er gilt als Bühne für queere Sichtbarkeit. Künstler*innen wie Nemo übermitteln nicht nur musikalische Botschaften, sondern auch politische Werte in die unterschiedlichsten Haushalte Europas. Mittlerweile steht der ESC für Diversität, Feminismus und Queerness. Pride-Symbole wie Regenbogenflaggen gehören zur Inszenierung des Events. Der ESC kann also durchaus als ein Ort der Anerkennung und des Feierns von queeren Menschen gesehen werden. Somit kann der ESC sicherlich als Teil einer queerfeministischen Revolution bezeichnet werden, indem er queere und feministische Werte sichtbar macht.
Ein weiterer Grossevent mit politischer Dimension ist die Frauenfussball-EM 2025 in der Schweiz. Auch hier entsteht Sichtbarkeit für FLINTA-Personen – in einer Sportart, die bis vor wenigen Jahren fast nur auf den Männersport fokussierte. Wachsende mediale Aufmerksamkeit, steigende Zuschauer*innenzahlen und verbesserte finanzielle Bedingungen können einen Fortschritt in Sachen Gleichstellung bewirken. Zudem bietet der Frauenfussball eine Plattform, auf der traditionelle Geschlechterrollen gebrochen werden können: Sportlerinnen*, die stark, selbstbewusst und teils queer auftreten, brechen mit alten Normen. Doch der Fussball ist weiterhin sehr patriarchal geprägt – Sexismus, Homophobie und ungleiche Bezahlung sind weiterhin Realität Die Frauen-EM kann wichtige Anstösse für eine queerfeministische Revolution geben und auf Missstände im Sport aufmerksam machen – als revolutionärer Raum im eigentlichen Sinne lässt sie sich jedoch noch nicht bezeichnen.
Des Weiteren bleibt die Frage, ob solche Grossereignisse gesellschaftliche Strukturen wirklich verändern können – oder ob Diversität und Gleichstellung nur oberflächlich inszeniert werden, um ein grösseres Publikum zu erreichen. Kommerzialisierung, mediale Kontrolle und Sponsoring schränken die Möglichkeiten einer queerfeministischen Revolution zusätzlich ein. Eine Infragestellung des Geschlechterverständnisses und der Geschlechterrollen ist daher im Frauenfussball nur möglich, solange der Profit stimmt.
Fazit: ESC und Frauen-EM können durchaus Teil einer queerfeministischen Revolution sein – vorausgesetzt, sie begnügen sich nicht mit reiner Sichtbarkeit, sondern tragen aktiv zu realen Veränderungen bei. Der ESC steht eher für symbolische Vielfalt, während die Frauen-EM strukturelle Ungleichheiten im Sport aufzeigt und Diskussionen über Geschlechtergerechtigkeit anstossen kann. Beide Grossanlässe haben das Potenzial, zur queerfeminsitischen Revolution beizutragen, werden aber durch die Kommerzialisierung eingeschränkt oder behindert. Ein grosser politischer Wandel erfordert mehr als eine Show und bequemes Zuschauen vom Sofa aus, auch wenn das zwischendurch notwendig ist 😊.